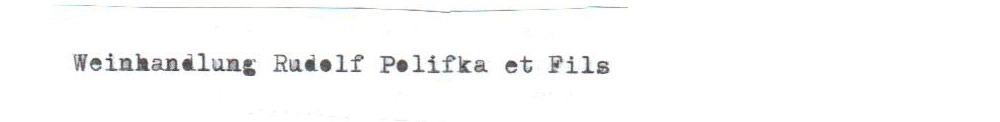Stimmen
In den Ohren vom jungen Rudl war sie damals eine der alleranstrengendsten Stimmen des Äthers, hysterisch-fröhlich und undezent-wichtigtuerisch. Heute gibt es wahrscheinlich noch viel anstrengendere Stimmen, aber das ist dem erwachsenen Rudl wurscht, weil der heute nicht mehr Ö3 hört. Vor dreißig Jahren war das anders. Da ist er am Sonntagabend vor dem Radioapparat gesessen und hat sich die Ö3-Hitparade angehört, sechsfünfsechssiebendreieins … Gibt es einen plausibleren Grund, nie mehr wieder Teenager sein zu wollen?
Idibus maiis 1985 a.D. & das Erwachsenwerden
Am 15. Mai 1985 ist da ein Lied in die Ö3-Hitparade eingestiegen, das – so pathetisch es klingt – die Leben von Rudolf Polifka und Bruce Springsteen verändern sollte: Feuer, Ostbahn-Kurti & die Chefpartie
Nur, ganz ehrlich und er tut sich schwer das zuzugeben: So richtig aufgefallen ist dem Rudl dieses Lied damals nicht gleich.
Das muss dann ein, zwei Wochen später gewesen sein: Der mit sechzehn Jahren immer noch nicht richtig pubertierende junge Herr Rudolf hat es wieder einmal beinahe geschafft, einen depressionsdräuenden Sonntag in einer Flauchgauer Tausendseelengemeinde ohne gravierende Schäden herunterzubiegen. Er sitzt vor dem Schwarz-Weiß-Bild des TV-Empfangsgeräts: Die großen Zehn.
A waunsinnige Brün
Da betritt einer die Bühne mit einem Overall, der dem des Moderators bedrohlich ähnlich schaut, und mit einer Brille, die damals Abonnenten der veröffentlichten Schmalspurigkeit vorbehalten ist. Der Typ mit dem Overall und der 3-D-Brille sagt irgendetwas von „dera waunsinnign Brün“, vermittels derer er jetzt „zum easchtn Moi“ in seinem Leben alles dreidimensional sehe, mit einer Stimme, die in ziemlich jeder Hinsicht das Gegenteil der Ansagerstimme ist.
Meilensteine
War es sofort oder war es nach dem Lied, das diese Musikkapelle dann zum Besten geben sollte? In diesen magischen Momenten hat der angehende Monsieur Rudolf gespürt: Jetzt kannst Du mit dem Erwachsenwerden anfangen. Mit dieser Musik kann dir nicht viel passieren. Er sollte sich nicht getäuscht haben.
Der Herr, der damals nicht nur das Leben vom Rudl ein für alle Mal in geregelte Eisenbahnen geleitet hat, genießt heute seinen wohlverdienten Ruhestand am Wiener Schafberg. Aber das Feuer brennt.
Und darum hat Monsieur Rudolf auf diesen Tag gewartet, um das vinifizierte Feuer offiziell zu entfachen:
Domaine Dominique Belluard, Le Feu, 2012
Die Rebsorte Gringet (vlg. Traminer oder Savagnin) ist in Savoyen dem Tal der Arve vorbehalten, sofern sie auf einen Appellationsstatus aus ist. Von diesem Tal schaut man direkt auf den Mont Blanc hinauf.
Eis eins
Anfang der Neunziger Jahre hat man dort in Bonneville durchschnittlich hundertfünfzehn Frosttage pro Jahr registriert. Sehr viel weniger werden es immer noch nicht sein. Gringet reift spät und hält der Kälte länger dagegen als viele andere Rebsorten. Die ganz großen Erträge sind da nicht drinnen, aber fünfzehn Hektar savoyenweit lassen das sowieso nicht vermuten. Die Weingärten strecken sich streng nach Süden und Süd-Osten, fallen mit mehr als vierzig Prozent ab. Sie stehen auf Konglomerat, Sandstein und rotem Ton.
Eis zwei
Auf einer kleinen Parzelle zwischen Ayse und Marignier dominiert der rote Ton dermaßen, dass man sie „sur le Feu“ nennt. Und dort kann es im Sommer ziemlich heiß werden. Fast so heiß wie auf der Gehsteigkante drüben bei der Grillgasse, wo die Alpen enden. Sie erinnern sich vielleicht … Sur le Feu ist aus Ablagerungen von eiszeitlichen Kaskaden gebildet worden. Die waren seinerzeit nicht nur eis-, sondern auch eisenhältig. Ein direkter Investigat muss man nicht sein, um jetzt zu ahnen, dass Le Feu genau dort wächst.
Ausbau und dergleichen
Der Wein gärt mit den eigenen Hefen aus dem Weingarten, wird minimal geschwefelt (weniger als dreißig Milligramm pro Liter) und besticht durch florale und exotische Noten, Zitrusfrüchte, Weingartenpfirsich, Anklänge an Menthol. So steht es auf der Homepage der Domaine Belluard. Dass man ihn gerne zu Hecht, Jakobsmuscheln und Langustinen trinkt, steht auch dort. Aber einer wie der Rudl, der wenig Fleisch und gar keine Tiere aus dem Wasser isst, dem schmeckt dieser Wein auch.
Engpässe
Darum hat es ihn auch drei Jahre so gewurmt, dass er nie einen bekommen oder aufgetrieben hat, bis er dann einmal wenigstens in einem Gasthaus ein Flascherl erstanden hat. Beim Winzer ist er bis heute erfolglos. Aber es gibt da den Herrn Jacques Maillet. Der vertreibt Weine von den Pétavins. Und weil er der Meinung ist, dass die Pétavins, eine Vereinigung von biodynamisch und biologisch arbeitenden Weinbauern aus Savoyen, .. weil also diese Pétavins ausgesprochen gute Weine machen, aber Dominique Belluard ohne Zertifizierung noch ein bissl bessere, verkauft er auch ein paar Flaschen von dem seinen Weinen. Weindepot braucht der Herr Jacques angesichts der kleinen Mengen, die es von diesen Weinen gibt, keines. Aber weil der Rudl den Weinen von Monsieur Maillet jetzt doch schon längere Zeit verbunden ist, ist er über diesen zu einer Zuteilung von vierundzwanzig Flaschen Le Feu gekommen. Die gelangen jetzt offiziell in den Umlauf.
Nicht ausschließlich diesen Wein, aber auch nicht weiß Gott wie viele andere gibt es
am Freitag, den 15. Mai
von 16 bis 22 Uhr
in der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22
Am Donnerstag, den 14. Mai ist die Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils geschlossen.
Caviste Rudolf grüßt die Damen und Herren Romeo, Julia, Samson sowie Delilah und wünscht Feuer in den Herzen und Hirnen!