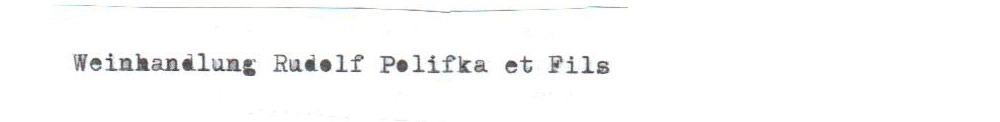Seinerzeit und heute
Es gibt eine paar Weine, die es dem Rudl angetan haben, seinerzeit als er vor knapp dreißig Jahren angefangen hat, sich für Wein zu begeistern. Die allermeisten davon gehen dem Rudl heute nicht ab.
Es gibt ein paar Weine, die es dem Rudl heute antun, die er damals ziemlich sicher nicht mit einem Übermaß an Enthusiasmus getrunken hätte.
Und dann gibt es ungefähr eine Handvoll Weine, für die Monsieur Rudolf vor einem Vierteljahrhundert schon weit gefahren ist und es heute immer noch tut, sei es mit dem Kinderwagen, sei es mit dem Radl oder sei es mit dem Automobil. Der Grüne Veltliner Spiegel von Sepp Mantler ist so ein Wein.
Löss
Der ist während der letzten Eiszeit vor etwa zwölftausend Jahren vom Gletscher abgeschliffen und im Anschluss daran vom Wind verblasen worden. Jetzt kann man so ein Terroir nicht direkt als jung bezeichnen. Zwölftausend Jahre sind nicht nix. Aber verglichen mit anderen relevanten Weingartenböden ist Löss geradezu ein Benjamin. Die Wachau, keine zehn Kilometer von Gedersdorf entfernt, ist zehntausendmal so alt, plusminus ein paar hundert Millionen Jahre.
Quantitativ ist Löss der österreichische Weingartenboden. Das Weinviertel ist Löss, nicht zur Gänze, aber schon ziemlich viel davon. Und das Weinviertel ist das mit Abstand größte Weinbaugebiet in Österreich. Dazu der ganzen Löss aus dem Kremstal, dem Kamptal und der Wachau. Und dann noch viel Löss im Burgenland und in Wien. Da läppert sich einiges zusammen.
Remarkabel ist auch, dass diese vom Wind dahergezahten Sandschichten äußerst kompakt sind, gerade so wie die, allerdings von der Rhône angeschwemmten, pickelharten Sandsteinhänge von Jacques Maillet in der Chautagne in Savoyen. So eine Härte möchte man dem Sand vielleicht gar nicht zutrauen. Aber die Wachauer Urgesteins-Terrassen aus Gneis und Granit müssen durch Mauern gestützt werden, die Lössterrassen im Kremstal nicht.
Bestehen tut Löss aus etwa fünfzig Percent der Reste des gymnasialen geologischen Schulwissens vom Rudl: viel Quarz, ein bissl Feldspat und Glimmer. Kalk ist auch dabei. Der gelbe Farbton ist auf die Eisenoxyde zurückzuführen. Alles in allem sind im Löss Mineralstoffe zum Saufüttern.
Spiegel
Spiegel ist eine Hanglage aus Löss. Die Anwehungen vom Gletscherschliff haben sich in der Riede Spiegel auf zehn Meter aufgehäuft, auch kein Lercherl und sicher auch nichts, was der Wind an einem verlängerten Wochenende erledigt hat.
Vor allem aber Sepp Mantler
Irgendetwas scheint es mit dem Winzervornamen Josef sowieso auf sich haben. Die Häufung von genialen Weinbaumeistern mit diesem Vornamen geht auf alle Fälle weit über jede statistische Nachvollziehbarkeit hinaus. Darüber hinaus fällt dem Rudl auf, dass in diesen Fällen oder vielleicht sowieso Kompetenz im Weingarten und im Keller mit besonderer Herzlichkeit und Authentizität einhergehen.
Derweil hat des Rudls Wissens auf alle Fälle noch niemand nachvollziehbar erklären können, wie Sepp Mantler aus Weintrauben, die auf Löss gewachsen sind, derartig subtile, differenzierte und ziemlich sicher auch heute noch langlebige Weine keltert. Man könnte das auch als Indiz für die Grenzen des Positivismus betrachten, wobei der Rudl da vorsichtig ist. Aber es gibt halt nicht viele Weine, die vierzehn oder sogar fünfzehn Percent Alkohol aufweisen und trotzdem grazil sind.
Dann ist da noch der Riesling Wieland. Wäre es der Rieslingrebe möglich, sich zu deplacieren, es würde sie vermutlich nicht zum Löss ziehen. Der Wieland von Sepp Mantler steht auf Löss, wobei sich unter dem Löss eines kleinen Teils der Riede Konglomerat befindet. Wenn es nach dem Rudl geht, einer der besten Rieslinge, wenn nicht der beste Riesling in Österreich.
2016
Zu warm und zu trocken im Winter. Früher Austrieb und dann der Spätfrost Ende April. Verhältnismäßig viel Niederschlag bis zur letzten Augustwoche. Erst dann kommt das Wetter zur Raison.
2013
Lieblingsjahrgang vom Rudl. Mit dem Kinderwagen transportiert.
2008
Über diesen Jahrgang hat Monsieur Rudolf letzte Woche das eine oder andere geschrieben. Am Mantlerhof hat Oidium den Ertrag noch ein bissl gravierender reduziert als anderswo, weil biologische Bewirtschaftung den Einsatz des Chemiekastens zur Bekämpfung von Pilzen und Viechern nicht vorsieht.
Herausgekommen ist Eleganz.
2006 und 2007
Vom Zweitausendsiebener und vom Zweitausendsechser hat der Rudl seinerzeit viel gekauft. Das hat Frau Mantler einmal beim Zahlen zur Frage, ob der Rudl denn ein Wiederverkäufer sei, veranlasst. Damals ist Herr Rudolf kein Wiederverkäufer gewesen. Und damals hat Herr Rudolf auch nicht geahnt, jemals einer sein zu werden. Die vielen Spiegel aus Zweitausendsieben und Zweitausendsechs hat der Rudl aber alle schon getrunken. A blede Gschicht, würde der Kurtl vielleicht sagen.
2004
Alles in allem kühl und feucht, was in Anbetracht des Trockenstresses im Dreierjahr für die Reben recht erholsam gewesen sein muss.
Im August ist es freundlicher geworden, im September ist es das geblieben und der Aromenausprägung nicht abträglich gewesen.
Zweitausendvierer, die man heute noch trinken mag, sind viel mehr als nur trinkbar.
2003
Erste Hitzewelle in der Woche nach Ostern. So ist es dann weiter gegangen. In Österreich für den Rudl nicht ganz nachvollziehbar hoch bewerteter Jahrgang. Wenn da jemand Elegance in den Wein gebracht hat, dann müssen es die ganzen Josefs und ihre Hawara gewesen sein.
1986
Winterfröste. Herr Rudolf meint, sich an minus siebenunzwanzig Grad in der Früh am Schulweg Ende Jänner erinnern zu können, im Bezirk Salzburg Umgebung.
Während der Blüte war es dann nass und kalt. Trotzdem ist einer der besten Jahrgänge daraus geworden. Für den Grünen Veltliner Spiegel vom Mantlerhof sollte es die letzte Ernte vor der Rodung und einer der berühmtesten Weine des Hauses werden. Seltene Liaison von Fülle und Frische.
1963
Viel Schnee im Winter, viel Hitze im Sommer, viel Niederschlag im September, viel Trockenheit im Oktober.
- Grüner Veltliner Spiegel 2016, Mantlerhof, Kremstal (4/6)
- Grüner Veltliner Spiegel 2013, Mantlerhof, Kremstal (4,50/7)
- Grüner Veltliner Spiegel 2008, Mantlerhof, Kremstal (5/8)
- Grüner Veltliner Spiegel 2004, Mantlerhof, Kremstal (6,50/10)
- Grüner Veltliner Spiegel 2003, Mantlerhof, Kremstal (7/11)
- Grüner Veltliner Spiegel 1986, Mantlerhof, Kremstal (10/16)
- Grüner Veltliner Spiegel 1963, Mantlerhof, Kremstal (15/24)
(in Klammern die Preise für das Sechzehntel und das Achtel)
Monsieur Rudolf ist sich bewusst, dass dieses Thema aus dem Rahmen fällt. Abgesehen vom Sechzehner handelt es sich um Einzelflaschen, beim Sechundachtziger um eine Halbliterflasche. Der Rudl kann nicht garantieren, dass am Freitag von allen Weinen noch etwas da ist. Unter 06 99 19 23 30 08 steht er gerne für Auskünfte bezüglich Niveau im einen oder anderen Flascherl zur Verfügung.
Selbstverständlich kredenzt der Rudl nicht ausschließlich Grünen Veltliner Spiegel vom Mantlerhof, so etwa immer noch die drei Vin Jaunes aus Arbois, den Côtes du Jura und Château-Chalon,
am Mittwoch, den 21. Februar und am Freitag, den 23. Februar
jeweils von 16 bis 22 Uhr
in der Weihandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22
Im Übrigen ist Rudolf Polifka der Meinung, dass man den 27. Jänner, den Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Vernichtungslager Auschwitz zu einem europäischen Feiertag erklären sollte!
Nachrichten aus dem Sortiment
Ab sofort sind die Steppenrindwürstel und die Mangalitzawürstel von Karlo aus Pamhagen wieder verfügbar.
Vorschau auf 21. und 23. Februar
Alles Gute zum Geburtstag, Josef Bauer, seines Zeichens Nicht-Lieblingsschüler von Friedrich Zweigelt!
Herr Rudolf grüßt ganz besonders Herrn Mantler und alle Josefinen und Josefs!