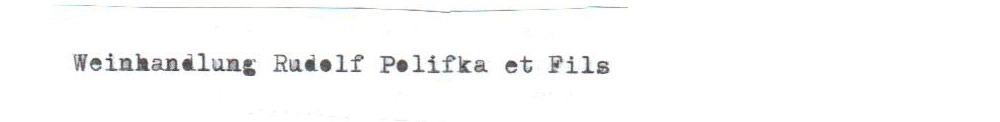Highlights
Jetzt heben sie schön langsam an, die Jahresrückblicke im Rundfunk. Die Sporthighlights des Jahres. Die innenpolitischen Highlights des Jahres. Die außenpolitischen Highlights des Jahres. Die Kulturhighlights des Jahres. Die Societyhighlights des Jahres. Die Insolvenzhighlights des Jahres. Und die Taubenzüchterhighlights des Jahres. Die größten Steuerreformhighlights des Jahres. Und die Highlighthighlights des Jahres. Nur auf die Finanztransaktionssteuerhighlights müssen wir überraschenderweise weiter warten. Der EU-Schuld sei Dank! Überraschenderweise.
… und Highlights
Monsieur Rudolf hat nichts gegen Lichter und Höhepunkte. Er versteht sie aber wie vieles gerne wörtlich. Ein Stern, ein Satellit, ein Flugzeug am Nachthimmel. Ein beleuchtetes Gipfelkreuz, eine beleuchtete Kapelle oder eine beleuchtete Bergstation. Das alles kann er sich stundenlang anschauen. Anders als eine in einem Mordstempo geschnittene Abfolge von Hansi-Hinterseer-Bildern, die von Toni Faber und Ulli Sima unterbrochen werden.
Jahrerückblick
Eine – möglicherweise von orthographieüberaffinen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen immer wieder aufgeworfene – Frage betrifft das sogenannte Fugen-s. Zumindest kommt das dem Rudl so vor. Das Fugen-s verbindet meistens zwei Teile eines Kompositums. Manchmal handelt es sich bei ihm um die Genetivendung des ersten Wortes, zum Beispiel bei Jahreswechsel. Manchmal erleichtert es auch nur die Aussprache wie in Zeitungsverkäufer. Wenn der letzte Laut des ersten Wortes und der erste Laut des zweiten Wortes sehr ähnlich oder sehr unähnlich sind, dann kann man eine ungewollte Kollision von Zähnen, Zunge, Lippe oder Gaumensegen unter Umständen verhindern, indem man ein s dazwischen schiebt. Ob es dann Zeitungsverkäufer oder Zeitungverkäufer heißt, gehört zu den Dingen, über die sich manche Deutschlehrer und manche Menschen, die Deutschlehrer gerne einer Wissenslücke überführen, gerne unterhalten. Der Rudl gehört quasi zu beiden Personenkreisen. Im Sinne der Logik Karl Valentins ist freilich beides ein Blödsinn. Da müsste es in Analogie zu den Semmelnknödeln sinnvollerweise Zeitungenverkäufer heißen, außer es ist ein Kolporteur mit ganz, ganz wenig Umsatz. Aber das würde Schulmeister Rudolf jetzt zu weit führen. Das Fugen-s ist, sofern keine Genetiv-Endung, sehr oft Geschmackssache. Da können Sie nicht viel falsch machen, es sei denn, das Fugen-s signifiziert einen Bedeutungsunterschied.
Ohne
Und auf so einen Bedeutungsunterschied will Linguoenologe Polifka hinaus, wenn er fugen-s-los zurückblickt, auf Jahre, nicht nur auf eines. Er hätte auch eine Vertikale ankündigen können, aber dann wäre dieser Newsletter ausgesprochen kurz ausgefallen. Oder es wäre wieder so viel um Wein gegangen. Herr Rudolf blickt auf die letzten fünf Jahre des Apremont von der Domaine Giachino aus Chapareillan zurück: 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014
Apremont
1973 wurde einigen Weinen Savoyens die Appellation Vin de Savoie zuerkannt. Fünfzehn Gemeinden haben darüber hinaus das Recht erhalten, dieser Appellation den Ortsnamen als Cru anzufügen.
„Apremont“ ist auf ein lateinisches asper mons, in der Bedeutung rauer Berg, zurückzuführen. Mit diesem Berg war der heutige Mont Granier gemeint.
Jacquère ist die Rebsorte für den Apremont. Man könnte meinen, die Rebsorte Jacquère sei extra für die vielen Fodues in den französischen Wintersportgebieten erfunden worden.
Gansl oder Fisch
Wo Weihnachten vom sackbauerischen Vater-Sohn-Konflikt – der Senior fordert traditionsbedacht ein Gansl, der aufmüpfige Junior einen Fisch – beeinträchtigt zu werden droht, ist ein Apremont zumindest in der Weinbegleitung ein nicht zu unterschätzender Kompromiss. Seine Frische passt zu Gerichten, die einem eher selten von Dietologen empfohlen werden. Aber auch ausgezeichnet zu Fisch. Und die ausgesprochen niedrigen Alkoholwerte sind in einer Zeit, in der das erste alkoholhältige Getränk nicht immer erst nach acht Uhr am Abend konsumiert wird, vielleicht auch kein Nachteil.
Ampelografie
Die Trauben des Jacquère geraten bei Vollreife zu einem hellen Rot. Besonders aromatisch sind sie nicht. Werden sie nicht drastisch zurück geschnitten, dann kann man champagneverdächtige 120 Hektoliter am Hektar ernten. Aber der Wein ist dann halt nicht besonders interessant.
Apremont, Domaine Giachino
David und Fred Giachino lassen dem Wein seine Feinhefe bis zur Füllung. Er wächst auf einer überwachsenen Geröllhalde und schmeckt nach Zitrusfrüchten, Bergamotten, Ananas, Wiesenkräutern und Feuerstein.
Apremont 2010, Domaine Giachino, AOC Vin de Savoie
Der letzte “grand millésime“. Ein extrem kalter Winter in Savoyen, dessen Niederschläge genug Feuchtigkeit für die gesamte Vegetationsperiode lieferten. Viel Sonne im Frühling. Extrem heißer Juli, Abkühlung im August, sonniger September, der für physiologisches Gleichgewicht gesorgt hat.
Apremont 2011, Domaine Giachino, AOC Vin de Savoie
Trockener Winter, gefolgt von einem ebensolchen Frühling. Achthundertfünfundfünfzig Sonnenstunden führen zu Frühreife. Knapp vor der setzen Niederschläge ein. Zum Glück ist Jacquère ziemlich resistent gegen beide Mehltaue.
Apremont 2012, Domaine Giachino, AOC Vin de Savoie
“Schawierig”, hätte Professor Conrads möglicherweise gesagt. Extrem kalter Winterausklang. Dann bleibt es kühl und regnerisch. Erst der August wird heiß. Der Ertrag bleibt gering.
Apremont 2013, Domaine Giachino, AOC Vin de Savoie
Erneut übermäßig kalt und feucht im Winter, scheußlicher Frühling. Nasser Juni. Das Wenige, was noch nicht verrottet ist, wird von einem heißen Juli gerettet, bevor ein Gutteil davon dem Hagel zum Opfer fällt. Eine lange Vegetationsperiode bringt qualitativ extraordinaire Weine, leider nicht viel davon.
Apremont 2014, Domaine Giachino, AOC Vin de Savoie
Ein Jahrhundertjahrgang der negativen Art, nicht nur in Savoyen.
Wie immer nicht ausschließlich diese fünf Weine glasweise
am Donnerstag, den 17. Dezember und am Freitag, den 18. Dezember
jeweils von 16 bis 22 Uhr,
sowie am Goldenen Sonntag, den 20. Dezember von 14 bis 18 Uhr
in der Weihandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22
Herr Rudolf grüßt, ganz besonders die Wiesenkräuter und hoffentlich bald den ersten Schnee!