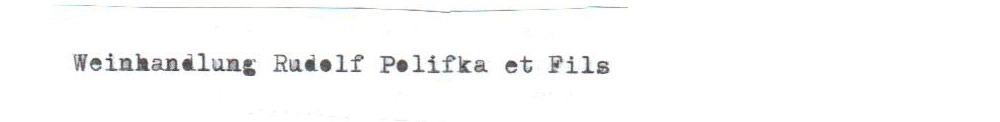Die Anhänger des FC Évian Thonon Gaillard besingen das „Croix de Savoie“, weil der Fusionsverein des 1924 gegründeten FC Gaillard von 2003 bis 2007 „Football Croix de Savoie 74“ geheißen hat. 2007 wurde der wiederum mit dem Olympique Thonon Chablais zum „Olympique Croix de Savoie 74“ fusioniert. Den heutigen, vergleichsweise unklingenden kreuzlosen Namen trägt der Verein übrigens seit 2009, nachdem im Dezember 2008 die ehemaligen französischen Teamspieler Zidane, Lizarazu und Boghossian Anteile an der Kapitalgesellschaft erworben haben.
Das Croix de Savoie ziert fast jedes savoyardische Weinetikett. Seit 1991, vermutlich als Vorbereitung auf die olympischen Winterspiele in Albertville, ist es in das Glas der „Savoyarde“, einer spezifisch savoyardischen Weinflasche, geprägt. Doch deren Zeit dürfte auch schon wieder vorbei sein. Immer mehr savoyardische Weine, vor allem interessantere, werden in Burgunderflaschen gefüllt. Und in der „Veronique“, einer Rheinweinflasche mit vier Ringen am oberen Hals, finden man fast nur mehr reife Weine.
Beim Croix de Savoie handelt es sich um das Wappen Savoyens, einer französischen Region mit bewegter Geschichte, die für fast alles bekannter ist als für ihren Wein. Aber das hat quantitative Gründe, keine qualitativen, findet der Rudl. Zweitausend Hektar Rebläche sind für eine Weinbauregion mit Renommée vermutlich zu wenig. Aber viele Weine, die dort wachsen, verdienen eine eingehendere Auseinandersetzung.
Zurück zum Wappen: Es zeigt eigentlich ein silbernes Kreuz auf rotem Grund, das von den meisten Grafikern zu einem weißen Kreuz auf rotem Grund abstrahiert wird, übrigens gerade so wie das beim eigentlich auch silbernen Wiener Wappen der Fall ist. Wo der Ursprung des Croix de Savoie liegt und ob es dort eine Verbindung zum Wiener Wappen gibt, hätte eigentlich Hauptinhalt dieser Zeilen sein sollen. Doch Schulmeister Rudolf vermochte es nicht zu eruieren. Für zweckdienliche heraldische Hinweise ist er dankbar.
Das Wiener Wappen und das Croix de Savoie scheinen spätestens im dreizehnten Jahrhundert verwendet worden zu sein, in beiden Fällen ist ein Kreuzzugshintergrund anzunehmen. Wo damals nicht?
Als Missing Link zwischen Savoyen und Wien würde sich natürlich Prinz Eugen Franz von Savoyen aufdrängen, nahe dessen Denkmal die Familie Sackbauer beim versuchten Besuch des Opernballs geparkt hat. Aber für einen Wappentransfer war es zur Zeit Eugens schon zu spät. Da war der Hafer schon geschnitten, um die von Kurt Ostbahn überlieferten Worte Hans Krankls zu strapazieren.
Prinz Eugen ist ein Wiener Idol, das es unbedingt zu militärischen Ehren bringen wollte und das deshalb kein langes Federlesen machte, als es um die Wahl des Herrscherhauses, für das er Dienst tun wollte, ging. Seine Wahl fiel auf das Haus Österreich, in dem die erhoffte militärische Laufbahn am wahrscheinlichsten schien. Trotzdem führte er die Hinweise auf seine italienischen und französischen Wurzeln im Namen und unterzeichnete mit dem italienischen Vornamen“Eugenio“, der deutschen Präposition „von“ und der französischen Regionsbezeichnung „Savoy“. Seine Entscheidung für Österreich wird er vermutlich eher nicht bereut haben. Schon mit zwanzig Jahren war er 1683 im Kader für die Schlacht am Kahlenberg. Heute kämpfen junge Sportler, die sich für Österreich entschieden haben, in diesem Alter gegen die Sperrstunde in Grazer Tanzlokalen und gegen alkoholhältige Getränke, die sie nicht vertragen.
In der Geschichte Savoyens spielt Eugen Franz keine so große Rolle. Die wird dominiert von einer Kette Amadei, deren Höhepunkt vermutlich Amédée VIII (1391 – 1440) darstellt. Der Sohn von Amédée VII, dem „Comte Rouge“ (der Rote Graf), leitete eine Periode besonderer Blüte in Savoyen ein. Amédée VIII führte 1430 gegen den Widerstand des Adels und der Städte in der Region um den Genfer See und Piemont ein umfassendes Gesetzbuch ein. Wie wäre der mit den Interessen der sogenannten „institutionellen Anleger“ in der Causa Hypo Alpe Adria verfahren? Und wie mit den Falotten, die das Fiasko verbrochen haben und sich jetzt dreist über Umfragerekordwerte freuen?
Amédée VIII zog sich vier Jahre nach der Einführung dieses Gesetzbuches übrigens weder in die EU-Kommission noch in den Vorstand irgendeines „institutionellen Anlegers“, sondern in die Kartause Ripaille am Genfer See zurück. Dort wird heute ein erfreulich tonischer Weißwein („Château de Ripaille“) und ein Rotwein, der nach seinem Vater „Le Comte Rouge“ benannt ist, gekeltert.
Aber anstatt nur mehr dem Rebensaft zuzusprechen wird Amédée VIII nur fünf weitere Jahre später auf dem Konzil von Basel zum Gegenpapst von Eugen IV gewählt und das, obwohl er nicht einmal dem Klerus angehörte. Amédée VIII gab sich als Heiliger Gegenvater den Namen Felix V. Ob dieser Name dem Glück der tollen Weine von Ripaille oder der überraschenden Wahl zum Gegenpapst geschuldet war, wissen wir nicht. Immerhin zehn Jahre hielt Felix V der üblen Propaganda des amtierenden Papstes stand. Einer der Höhepunkte der Schmutzkübelkampagne von Eugen IV war 1440 eine Bulle, in der er unter anderem die Savoyer Alpen und das Aosta Tal als Hort von Hexen und Ketzern diskreditierte. Und noch heute haben die Bewohner der savoyardischen Alpen den Ruf von Querköpfen. Zum Glück nicht ganz zu Unrecht. Denn ginge es nach den Kontrollneurotikern der INAO, des „Institut national de l’origine et de la qualité“, dann sähen die kleinen Weinberge Savoyens mit ihren nicht ganz übersichtlichen 22 Crus und den mehr als zwölf Rebsorten vermutlich anders aus.
Als Reverenz an den savoyardischen Eigensinn gibt es diese Woche nach dem zugegebenermaßen nicht ganz ungewagten „Reife-Schilcher-Thema“ der Vorwoche quasi eine Bank: les Vins de Savoie. Die roten der spät reifenden Rebsorte Mondeuse, die sich vor allem auf Schiefer- und Kalkgeröllböden von ihrer besten schwarzgepfefferten Seite zeigt: Jacques Maillet, Frédéric Giachino, beide Mondeusen von der Domaine Saint Germain: „Le Pied de la Barme“ und „Le Taillis“ und ein „La Brova“ 2005 vom Rotweindoyen Savoyens, Louis Magnin – alle zusammen von Biowinzern.
Die weißen Weine sind von des Rudls Lieblingscepage: Altesse, zu Recht auf Deutsch „Hoheit“ genannt, als einzige Rebsortenappellation Savoyens auch Roussette genannt. Vermutlich 1366 wurde sie von Amédée VI. vom Kreuzrückzug aus Zypern mitgebracht. Die wirklich segensreichen Dingen sind aus dem Morgenland in das Abendland gelangt, zumindest bis man dort Erdöl entdeckt hat. Der Ampelograph Pierre Galet bringt die Altesse mit dem ungarischen Furmint in Verbindung. In voller Reife bringen die rötlichen Trauben elegant-rassige Weine mit einem unnachahmlichen Aroma nach Bergamotten, Haselnüssen, Mandeln, Honig und Lindenblüten hervor. Die drei Altesse von Jacques Maillet (Chautagne, über hundert Jahre alte Rebstöcke auf Sandstein), von Frédéric Giachino (Kalksteingeröll) und Noёl Dupasquier (Jongieux, von mit dem Pickel in Kalkfelsen gehauenen Rebstöcken) könnte der eine oder andere Besucher der „Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils“ schon einmal getrunken haben. Zusätzlich wird es eine Altesse vom biodynamischen Winzer Michel Grisard geben. Der ist gemeinsam mit Nicolas Joly (Coulée de Serrant) Gründungsmitglied der „Renaissance des Appellations“. Die setzt sich für die Unverwechselbarkeit von Weinen ein. Die vier Faktoren Temperatur, Licht, Wasserversorgung und Geologie arbeiten überall auf dieser Welt auf eine ganz bestimmte eigene Art zusammen. Und ein Wein, der nicht durch eine Unzahl an Herbiziden, Pestiziden, Aromaheferln und anderen segensreichen Interventionsmitteln verhunzt ist, sollte genau von diesem überall einzigartigen Zusammenspiel von Temperatur, Licht, Wasserversorgung und Gestein geprägt sein. Paradoxerweise wird gerade dem Altesse von Michel Grisard immer wieder die Appellation „Vin de Savoie“ verweigert, weswegen der Wein 2005 „Altesse le Refus“ (Altesse die Verweigerung, Ablehnung) geheißen hat. Ganz fremd muss einem das im DAC-Raiffeisenweinland nicht sein. Und für Verweigerer der Verweigerung gibt es die konventionelle Variante der Grisard-Altesse von den Brüdern von Michel: Philippe und Jean-Pierre
am Mittwoch, den 19. März und am Freitag, den 21. März
von 16 bis 22 Uhr
in der „Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils“, Reindorfgasse 22
Wenn Sie diese Zeilen bis hierher gelesen haben, dann bedankt sich Herr Rudolf dafür auf das Heftigste. Es war der bisher vermutlich längste Newsletter des Rudl.
Merci! Monsieur Rudolf