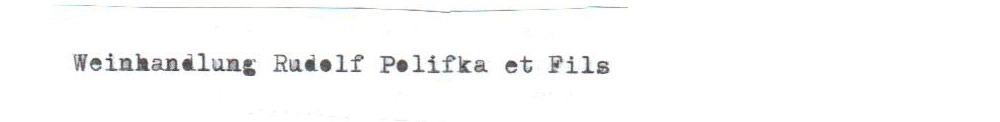Kriterien für Reifepotential
Seit September 1992 fasziniert Oenologierat Rudolf Polifka das Reifungsverhalten von Wein. Der Rudl ist damals dreiundzwanzig Jahre alte gewesen. Jugendforscher meinen, herausgearbeitet zu haben, dass junge Erwachsene, die sie „Millennials“ nennen, sich tendenziell durch einen reservierten Zugang zu Alkohol auszeichnen. Schulrat Rudolf hält das durchaus für möglich, kennt aber auch die eine oder andere Ausnahme und würde vor allem nicht unterschätzen, dass auch heute nicht immer alle Jugendlichen über einen Kamm zu scheren sind. Die Entwicklungspsychologie nennt das Pubertät, wenn sich der Rudl nicht irrt. So oder so, die ersten halbwegs selektiven oenologischen Beurteilungskriterien für Wein haben sich im Fall vom Rudl auf das Reifungsverhalten bezogen. Mit entsprechenden Fragen hat er die Weinbäuerinnen und Weinbauern seinerzeit konfrontiert. Immer wieder sind dabei die Kategorien Restzucker, Alkohol und Säure genannt worden, gelegentlich durchaus auch ein vernünftiges Verhältnis aller dreier zueinander. Daran zweifelt der Rudl bis heute nicht. Zu viele entsprechende Erfahrungen hat er dazu getrunken, aber durchaus auch die eine oder andere gegensätzliche gemacht. Ob es sich bei Restzucker, Alkoholgrad und Säure um gleichrangige Parameter für die Gewährleistung von Reifepotential handelt, erscheint dem Rudl als zumindest ungeklärt, eher sogar als fraglich. Darum wird er sich erlauben, kommende Woche jeweils zwei Weine zu Säure, Restzucker und Alkohol glasweise zu kredenzen. Diese Weine sollten in ihrem Reifeverhalten von einem der drei Kriterien dominant geprägt sein. Der Auswahl wird man eine gewisse Willkürlichkeit nicht absprechen können. Sie ist naturgemäß vom Sortiment des Cavisten geprägt, kann jedoch im Selbststudium ergänzt und so ein Stück weit der Systematik nähergebracht werden.
Säure
Sehr lange Zeit hat der Rudl diese als ganz besonders relevant für das Reifepotential eines Weines erachtet. Und wenn es darum geht, die für den biologischen Säureabbau zuständigen Bakterien ohne Schwefel daran zu hindern, ein Interesse für Traubenzucker zu entwickeln, bevor die Hefen ihre Mission erfolgreich abgeschlossen haben, dann kommt der Apfelsäure eine ganz wichtige Rolle bei der Verhinderung der Bildung von flüchtiger Säure zu. Aber dann gibt es Weine, deren Apfelsäuregehalt so hoch ist, dass eine Malo gar nicht in Gang kommt. Ob das die allgünstigsten Voraussetzungen für ein Altern in Würde sind, bezweifelt der Rudl immer stärker. Als epochale Erkenntnis wird die Feststellung, dass Säure nicht gleich Säure ist, schwer durchgehen. Aber vielleicht manifestieren sich gerade beim Reifeverhalten die Unterschiede zwischen Apfelsäure, Zitronensäure, Milchsäure und vor allem Weinsäure ganz besonders. Zur Weinsäure aber später mehr.
- 2014 Sauvignon blanc, Kåarriegel, Sankt Andrä im Sausal, Südsteiermark (4,50/7)
säureintensiver Jahrgang, wenn es in diesem Jahrtausend einen gegeben hat, säureintensive Rebsorte
- 2021 Mondeuse « Mattäi », Côteaux des Girdonales, Villaz, Haute Savoie, Vin de France (5/8)
Für dunkle Trauben hat Mondeuse eine ziemlich markante Säure. Danach kommt vielleicht nur noch Teran. Der Jahrgang 2021 war in ganz Frankreich und darüber hinaus kühl, deshalb auch der Säure gewogen. Die Lage in Villaz hoch oben über dem Nordufer des Lac d’Annecy kann man als äußerst frisch bezeichnen.
Zucker
Bis Mitte der achtziger Jahre galt in Österreich der Zuckergrad als das Kriterium zur Beurteilung von Weinqualität. Die Folgen sind bekannt und jähren sich gerade zum vierzigsten Mal. Erstaunlich kurze Zeit später hat dann bereits moderates Aufzuckern als Sakrileg gegolten. Der Rudl hätte mir einer Zuckerdosage, die ein halbes Percent Alkohol mit sich bringt, weniger Probleme als mit Gummibeerenhefen oder anderen Segnungen aus der Chemiekasten. Aber das Aufzuckern hat inzwischen sowieso die Erderwärmung erledigt. Resultiert Zucker aus der Photosynthese in den Weinblättern, dürfte er ein kompetenteres Alterungsgeheimnis sein als alles, was tech-faschistische Ka-I-Transhumanisten je zusammenbringen werden.
- 2015 Prieuré Saint Christophe blanc, Domaine Giachino, Chapareillan, AOC Roussette de Savoie (6,50/10)
Erster Jahrgang der Giachinos aus dem Weingarten von Michel Grisard; Der Zuckerrest war nicht beabsichtigter, aber die Giachinos haben ihn zugelassen. Nach zehn Jahren bedankt sich der Wein jetzt mit Harmonie und Vielschichtigkeit.
- 2009 Fleur d’Altesse, Domaine Dupasquier, Aimavigne, AOC Alkohol (6,50/10)
Sehr oft machen die Dupasquiers diesen Wein nicht. Weine aus der Rebsorte Altesse sollte man, wenn Sie den Rudl fragen, so oder so nicht zu jung trinken. Wenn dann auch noch Traubenzucker dem Sauerstoff das Leben schwer macht, hat der Alterston keinen Auftrag.
Alkohol
Ein besonderer Freund von heißen Jahrgängen ist der Rudl nicht. Allerdings
hat er gelesen, dass so eine Affenhitze lediglich der Apfelsäure in den Beeren zusetzt, wohingegen sie der Weinsäure wenig anhaben kann, sofern die hohen Temperaturen nicht von Regentropfen assistiert werden. Der Rudl tendiert sowieso immer mehr zur Annahme, dass es die Weinsäure ist, der Weine ein allfällig hohes Reifepotential verdanken. Das würde erklären, dass manche Weine, die ihren Alkohol nicht kaschieren, veritable Jahrhundertweine sind – der Jahrgang 1947 war ein extremer Hitzejahrgang -, wohingegen andere bereits nach wenigen Jahren mit ihrem Latein am Ende sind. Wenn der hohe Alkohol mit viel Weinsäure einhergeht, das ist in heißen, trockenen Sommern gar nicht so selten, dann können das grandiose Weine werden.
- 2019 Chignin-Bergeron „Les Filles“, Chignin, AOC Vin de Savoie (7/11)
- 2008 Clos de la Coulée de Serrant, Nicolas Joly, Savennières, AOC Savennières – Coulée de Serrant (16/24)
fünf Lesedurchgänge zur Gewährleistung der für den Weinbauern optimalen Reife mit dem Ziel, Terroir und Boden bestmöglich zum Ausdruck zu bringen und ein ideales Reifungspotential zu gewährleisten, fünfundzwanzig Hectoliter am Hectar, fünfzehn Percent Alkohol
Darüber hinaus gibt es selbstverständlich andere Reifekriterien wie Kohlensäure, Schwefel oder Sauerstoff. Im Anschluss an Vin Jaune gibt es die Theorie, dass Sauerstoffkontakt im Zuge der Vinifizierung gewisse Teilchen im Wein oxydieren lässt, diese dann ausfallen und der Rest des Weines umso resistenter gegen Oxydation ist. Auch die Lagerbedingungen sind nicht zu vergessen, wobei die Bedeutung von Dunkelheit gelegentlich unterschätzt zu werden scheint, weshalb der Rudl auch gar nichts von längerer Lagerung in Weinklimaschränken mit Glastüre hält.
Donnerstag, 2. Oktober von 17 bis 21 Uhr
Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22
Im Übrigen ist der Rudl der Meinung, dass der 27. Jänner, der Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Konzentrationslager Auschwitz, zu einem gesamteuropäischen Feiertag erklärt werden muss.
Jung und frisch grüßt Rudolf Polifka!
Schicken Sie ein entsprechendes E-Mail, wenn Sie keine Nachrichten der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils bekommen möchten.
Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22, 1150 Wien