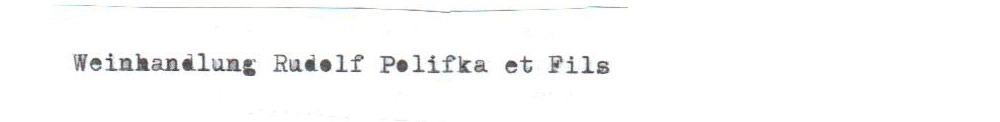Der Gefahr, Sie mit nicht ganz sentimentalitätsfreien Zeilen zu strapazieren, ins Auge blickend muss der Rudl für dieses Semester ein letztes Mal ein paar Worte über den Frühling in die Tastatur seines mobilen Nicht-Endgerätes nageln. Sollten Ihnen die Überlegungen rund um das Wetter im Wandel der Zeiten auf den Zeiger gehen, könnten Sie ein paar Zeilen überspringen und bei der Zwischenüberschrift „Sauvignonsubstitut“ weiter lesen.
Dort, wo Monsieur Rudolf vor gut vierzig Jahren aufgewachsen ist, dort war damals noch dieser Winter. Der hat dort irgendwann Ende November oder Anfang Dezember eine unterschiedlich dicke, aber ziemlich lückenlose Decke über die Wiesen und Wälder gezogen. Das war an sich schon eine aufregende Sache. Eine Spur aufregender war es für den Rudl dann immer, wenn Ende Februar oder Anfang März die Sonne den Blick auf bis dahin drei Monate lang verborgene Plätze, Pflanzen und Utensilien freigelegt hat. Die hat man gut und klar in Erinnerung gehabt. Die nicht gerade spärliche Freizeit war damals dort kaum anders zu verbringen, als in Bachbetten herum zu graben oder irgendwo im Freien herumzurennen, zu kraxeln oder zu hängen und auf Veränderungen zu warten, von denen man sowieso gespürt hat, dass sie sich nicht einstellen würden, zumindest nicht vor Godot. Eine verwelkte Krenstaude, ein Holzbrettl oder vielleicht sogar ein fast vergessenes Spielzeug nach Monaten wieder zu sehen war zumindest interessant. Der Rudl kann sich sogar an eine Zehner-Münze erinnern, die er im Winter im Schnee verloren hatte und Wochen später nach der Schneeschmelze wieder in sein Geldtaschl integriert hat.
Drum wird es den Herrn Rudolf stets begeistern, wenn nach einem Winter die Vegetation den Dienst wieder antritt. Seine Begeisterung wird immer mit einem Anflug kindlicher Freude einher gehen und diese Freude wird immer in einem Schokoladeosterhasen in einer bunten Staniolpanier unter einem Strauch seinen schwer überbietbaren Höhepunkt erblicken. Sentimentale Verklärung hin oder her, aber so schaut es halt einmal aus.
Weinsubstitut
Schokoladeosterhasenmäßig ist der Rudl mittlerweile vom Bekommer eines solchen zum fast noch begeisterteren Verstecker geworden. Einer konsumierbaren Vergegenständlichung des anbrechenden Frühlings wollte er deshalb aber nicht gleich entraten. So ist Wein der Rebsorte Sauvignon Blanc zur Entsprechung des Osthasen in Staniolpanier geworden. Das hat der Rudl an dieser Stelle des ziemlich Langen und Breiten letzte Woche entfaltet. Dass vielen Sauvignons dann irgendwann die Schuhe des Schokoladeosterhasen um ein paar Nummern zu groß geworden sind, ist sicher nicht auf die Schuhe des Osterhasen zurückzuführen. Vielleicht haben sich die Sauvignons auch nur zu sehr dem Zeug, das sonst in Osternestern herum liegt, assimiliert.
Sauvignonsubstitut
Wie vor gut zwanzig Jahren Sauvignon Blanc die Agenden des Schokoladeosterhasen übernehmen musste, hat sie ihm Jacquère beim ersten längeren Savoyenaufenthalt des Rudl wieder abgenommen. Heute sprießen Schlüsselblumen, Obstbaumblüten und Löwenzahn vor dem geisten Auge des Rudl aus einem Weinglas mit Jacquère. Und dieser Aufgabe kommt Jacquère mit Kompetenz und Verlässlichkeit nach. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sich Caviste Rudolf dieser Rebsorte nicht in der Breite, sondern vom oberen Ende des Qualitätsspektrums genähert hat, was bei Jacquère um ein paar Häuser kostengünstiger ist als bei Sauvignon Blanc.
Jacquère „als Solches“
Etliches von dem, wovon Sie, geneigte Oenologin, gewogener Oenologe, Schulmeister Rudolf im Folgenden in Kenntnis setzt, hat er so oder so ähnlich irgendwann schon einmal anlässlich des Themas „Weine mit weniger als zwölf Percent Alkohol“ zum Besten gegeben. Da sind damals naturgemäß eine ganze Reihe Jacquères mit von der Partie gewesen. Und von den sieben Jacquères, die Caviste Rudolf diese Woche offen zur Ausschank bringt, weist ein einziger mehr als elf Percent Alkohol auf.
Accorde
Wahrscheinlich zu oft endet Jacquère als Fonduebegleiter in den einschlägigen Skigebieten, als Winterwein, um nicht zu schreiben als Aprèsskiwein. Caviste Rudolf findet die Koalition mit dem Fondue säuretechnisch nicht ganz unpassend, ein bissl ideenlos aber schon. Kann man von einem Fondue nicht sowieso fast jeden Wein erschlagen lassen? So wie viele angeblich kongeniale Wildbegleiter gelegentlich auf ihren hohen Alkoholwert oder die Röstaromen in ihrem Fassl reduziert werden, läuft Jacquère neben dem Fondue Gefahr, zum Säureaufputz zu verkommen. Das ist schade und ein bissl vergleichbar mit einem Schulmeister – heute heißt man das „Lehrkraft“ und kaum eine solche scheint das zu stören, was wiederum dem Rudl die Frage nach der Beschaffenheit dieser „Kraft“ stellt -, der einen Schüler für dessen gesamte Schullaufbahn als Witzbold behandelt, nur weil der in der allerersten Stunde irgendeine mehr oder weniger lustige Bemerkung von sich gegeben hat.
Der kulinarische Deckel für den Topf einer gelungenen Jacquère, sofern man einen Wein als Topf bezeichnen kann, ist wahrscheinlich die Bachforelle. Das dezente Prickeln, der niedrige Alkohol, das kongeniale Zusammenspiel von Frische, Leichtigkeit und appetitanregendem Temperament der Jacquère erinnern den Rudl an einen Gebirgsbach während der Schneeschmelze. Wenn er bei vielen Weinen aus dem Elsass an den Rhein denkt, dann symbolisieren savoyardische den Zubringer eines Zubringers der Isère. Einem wie dem Rudl, der quasi neben, beziehungsweise in Wald- und Wiesenbächen seine Kindheit verbracht hat, der Donau aber erst im stolzen Alter von vierzehn gewahr wurde, stehen kleine Gebirgsbäche und Wasserfälle und ihre korrelierenden Weine vielleicht näher. Der ist mit der Bachforelle quasi per Du wie der Cagney mit seiner Limousin.
Quidquid id est, Frische, Lebendigkeit und Bekömmlichkeit der Jacquère schreiben förmlich nach einer Essensbegleitung. Darum nützt der Rudl wieder einmal die Gelegenheit, Sie daran zu erinnern, dass es ausdrücklich erwünscht ist, wenn Sie sich selber etwas zum Essen in die Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils mitbringen, ob das jetzt eine Bachforelle, eine Stelze – Monsieur Rudolf kocht die mit Heu und Chartreusekräutern – oder etwas ganz anderes ist. Wenn Sie sich etwas mitbringen, wird Ihnen der Rudl das mitgebrachte Papperl durch ein nach Möglichkeit von ihm selber höchst eigenhändig gefärbtes Bio-Osterei upgraden. Bringen Sie sich nichts mit, kriegen Sie ein solches Bio-Osterei selbstverständlich auch.
Crus
In und um drei Orte darf Jacquère einen Cru-Status beanspruchen, Abymes, Apremont und Chignin, alle drei im Combe de Savoie. Das Projekt, die gelungenen Exemplare dieser Crus im gereiften Stadium zu vergleichen, hat der Rudl nicht aufgegeben. Bis jetzt scheitert es daran, dass die Giachinos ihren Abymes nicht mehr machen und Caviste Rudolf noch keinen anderen passablen gefunden hat.
Jacquère ist nicht Jacquère ist nicht Jacquère ist nicht Jacquère
Es gibt Jacquères, denen das Glühweingewürzsackerl quasi als Schicksal in die Wiege gehängt worden zu sein scheint.
Es gibt auch Jacquères, die ausgesprochen ambitioniert, vor allem bodenspezifisch ausgebaut, aber mit einem synthetischen Korkimitator zugestoppselt werden. Ein Jammer.
Dann gibt es Jacquères von den Pétavins, einer Vereinigung biologisch und biodynamisch arbeitender Weinbauern aus Savoyen.
Und dann gibt es Jacquères von den Gebrüdern Giachino, denen das Ausloten der Möglichkeiten dieser Rebsorte eine Herzensangelegenheit ist. Knapp mehr als tausend Hektar sind in Savoyen mit Jacquère bestockt. Mehr oder weniger handelt es sich bei diesen tausend Hektar um die weltweite Fläche an Jacquèreweingärten. Ganz präzise hat sie ihren Ursprung, soweit man das rekonstruieren kann, in Abymes de Myans. Das liegt am nordöstlichen Rand des Chartreusegebirges.
Die dicken Beerenschalen erlauben eine für die steinigen und kalkreichen Weingärten am Fuß der Alpen späte Reife und schützen die engbeerigen Trauben vor Oïdium und Meltau.
Die leicht ovalen Beeren sind durchschnittlich groß. Sind sie sehr reif, werden sie rötlich. Eine „schmeckate Rebsorte“ ist etwas anderes. Diesbezüglich hat Jacquère mit Muscadet viel mehr gemeinsam als mit Muskateller.
Als Wein ist Jacquère mit „weißgold“ farblich überhaupt nicht gut getroffen. Trotzdem liest man das immer wieder. Aber Farbzuschreibungen müssen bei Wein sowieso von Farbenblinden geschrieben werden. Den Verdacht hat zumindest der Rudl. In der Nase erinnert er an vieles, was im Frühling blüht. Dem Rudl seinem Geschmack nach stehen Alpenkräuter, Grapefruit, Bergamotte, Wacholder und aneinander geriebener Feuerstein im Vordergrund, Letzteres aber nur für den Fall, dass die Jacquère auf kargem Boden steht und im Ertrag eingebremst wird, im Idealfall vom Alter der Reben und einer hohen Konzentration an Steinderln im Boden. Ungebremst und auf fetten Böden neigt sie quantitativ zu Übertreibungen, was ihr eine schlechte Nachred und den Weinen einen blassen Charakter einträgt. Manchmal sollen Mandeln, Haselnüsse und Lindenblüten dazukommen, wenngleich nie so intensiv wie bei ihrer autochthonen Kollegin Altesse.
Wenn man die Auflistungen der alternativen Namen für „Jacquère“ auf Wikipedia liest, könnte man glatt den Eindruck gewinnen, dass da eh jeder sagen kann, wie er will. In der Gemeinde Roussillon etwa heißen sie die Jacquère Coufe-Chien. In Conflans gibt es zwar keine Weingärten mehr, aber auch eine lokale Sonderbezeichnung: Robinet. Das bedeutet Wasserhahn und könnte auf die Ertragsfreudigkeit anspielen. Bezeichnungen wie Altesse de Saint-Chef oder Roussette sind dann fast schon als Frotzelei oder Urheberrechtsverletzungen zu betrachten, aber bitte.
Jacques Maillet …
… ist ein Original. Um das zu bemerken, muss man ihm nicht besonders lange zuhören. Ein Schnurrbart als Lebenshaltung. Wenn Passionierte vom Weinforum La Passion du Vin Recht haben, kann man der Jacquère von Jacques Maillet Pouilly-Fumés von Dagueneau an die Seite stellen, ohne dass erstere schlecht dasteht.
Seine Art, Wein zu machen, nennt Jacques Maillet Ni-Ni-Ni. Das ist kein Zitat aus einem genialen Film der Monty Pythons über die Artussage, sondern heißt vielmehr „Weder-noch-und schon gar nicht“. Gemeint ist, dass Jacques seine Weine in keiner Weise anreichert, nicht filtriert und auch nicht schönt, wenn irgendwie möglich auch nicht oder nur ganz minimalistisch schwefelt.
Am übereifrigen Ertrag müssen die Jacquère-Reben von Jacques Maillet nicht gehindert werden. Dazu sind sie zu alt und zu konsequent selektioniert.
Jacquère, Mondeuse und Altesse stehen im Weingarten „Cellier des Pauvres“. Der ist süd-westlich ausgerichtet und weist eine Steigung von zwanzig bis fünfzig Percent auf. Er schaut aus mehr oder weniger dreihundert Metern Meereshöhe auf die Rhône hinunter. Wein aus dem Rhônetal, aber nicht aus der Weinbauregion Rhône, dazu ist das noch zu weit am Oberlauf des gleichnamigen Baches.
Der pickelharte Sandstein und das Geröll aus Ton und Kalk sind charakteristisch für die Chautagen, eine Rotweinenklave in der Weinbauregion Savoien. Mittlerweile quittiert Monsieur Jacques es mit einem milden Lächeln, wenn der Rudl in privater Mission bei ihm trotzdem immer Weißwein kauft. Und der Rudl hat es inzwischen auch kapiert, dass die Mondeuse von Jacques Maillet ein beachtenswerter Wein ist.
Die Chautagen, aber das hat Monsieur Polifka auch schon mitgeteilt, wird „Provence de Savoie“ genannt. Olivenbäume und ein paar andere Pflanzerl deuten darauf hin, dass es sich dabei nicht um Angeberei des örtlichen Tourismusverbandes handelt.
David und Fréd Giachino
Monsieur Jacques Kollegen, die Gebrüder Giachino haben die Jacquère auf die Spitze getrieben. Außer Weinbeißer machen sie fast alles aus Jacquère, lagentechnisch und weinstiltechnisch. Den Cru Apremont, den Monfarina, den rustikal ursprünglichen Primitif mit 9,2 Prozent Alkohol, einen dezent auf der Maische vergorenen Marius et Simone, einen Schaumwein nach der Méthode Traditionelle und einen Pétillant Naturel Giac‘ Bulles als Giachinos Antwort auf das koffeinhältige Blechdosengetränk.
Die Revue du Vin de France hofft, dass mehr Weinbauern in der Region dem Beispiel der Giachinos folgen und bedauert, dass die Weine der Giachinos schnell ausverkauft sind.
Die Reben stehen auf der Geröllhalde eines Felssturzes unter dem Mont Granier, dem nördlichen Ende des Chartreusemassivs. Auch sie muss niemand bremsen.
Monfarina 2015, Giachino
Kalk und Mergel am Fuß des Mont Granier. Seit neuem gesellen sich etwas Mondeuse Blanche und Verdesse zu Madame Jacquère.
Apremont 2015, Giachino
Jacquèrerebstöcke an den Ufern des Lac de Saint André, wobei Lac hier schon ein bissl dick aufgetragen scheint. Der Wienerberger Teich dürfte größer sein. Dass rund um den Lac de Saint André die größten Felsblöcke des Felssturzes von 1248 herumliegen, ist dagegen nicht dick aufgetragen. Die sind schätzungsweise am weitesten herunter gekugelt. Dazwischen wächst der Apremont von Giachino.
Offengestanden hat sich Caviste Rudolf immer schwer getan, den Unterschied zwischen Monfarina und Apremont von Giachino zu beschreiben. Darum hat er quasi als Recherchearbeit für die Lehrveranstaltung dieser Woche jeweils ein Flascherl mit nach Hause genommen, kostet jetzt seit dem Öffnen am Samstag daran herum und nötigt sein engeres soziales Umfeld, es ihm gleich zu tun. Die Unterschiede präzise beschreiben kann er immer noch nicht. Vielleicht ist Monfarina etwas bitterer, karger und steiniger und der Apremont eine Spur offener, mit einem sehr dezenten Hinweis auf Ananas und Hollerblüten, aber allenfalls sehr dezent.
Primitif 2010, Giachino
Sehr früh gelesen. So könnte Wein aus Savoyen geschmeckt haben, bevor Oenologie in den Kellern Einzug gehalten hat. Neun Percent Alkohol, den Giachinos zufolge mit Affinität zum Biss in eine Traube, dem Rudl zufolge mit einer zum Verjus. Spontanvergoren, drei Monate auf der Feinhefe, fast virtuos kaschierter Säureabbau, sowieso auch keine Zutaten. Den Trinkhorizont geben die Giachinos auf ihrer Homepage mit 1 bis 100 Jahren an. Ausverkauft ist der Wein bei ihnen immer schon früher.
Zu trinken mehr oder weniger wie kristallines Quellwasser mit viel Zitronenzesten. Da fällt dem Rudl die letzte Kottan-Folge „Mabuse kehrt zurück“ ein …
Marius & Simone 2015, Giachino
Eine Hommage an die Großeltern der Giachinos. Er, der alte Giachino soll begeistert ein Glasl getrunken und sie, die alte Giachino, ebenso begeistert darüber geschimpft haben.
Zwei Tage Vorgärung, dann zwanzig auf der Maische, vom Tank ins Fass, zehn Monate auf der Feinhefe, minimale Schwefelzugabe von einem Gramm pro Hektoliter, das aber auch erst bei der Füllung.
Zum bereits Erwähnten kommen Mandel- und Haselnussanklänge.
Apremont „Lisa“ 2015, Jean Masson et Fils, Apremont, AOP Vin de Savoie
Was Jacquère des Cru Apremont betrifft, ist ziemlich sicher niemand so verrückt wie Jean Masson. Auf neun Hektar erntet er Trauben für zehn verschiedene Apremonts, teilweise von hundert Jahre alten Rebstöcken. Man ist stolz, Wein aus Trauben zu machen, ohne Tralala, ohne Holzfässer und ohne Zertifizierungen. Bedauerlicherweise heute auch ohne Naturkork. Die Kraft, die diese Weine mit Flaschenreife entwickeln, kann man am Weingut verkosten oder in ganz wenigen Vinotheken ziemlich teuer kaufen. Die synthetischen Stoppeln werden, fürchtet der Rudl, eine Beschreibung des Potentials aktueller Jahrgänge nur im Konjunktiv zulassen. Dem Zweitausendfünfzehner sollte das Korkimitat jetzt noch nicht allzu sehr zugesetzt haben.
Jacquère 2014, Dupasquier, Aimavigne, AOP Vin de Savoie (2,50/4)
Jacquère 2015, Jacques Maillet, Chautagne, AOP Vin de Savoie (4/6)
Primitif 2010, Giachino, Chapareillan, AOC Vin de Savoie (2,50/4)
Monfarina 2015, Giachino, Chapareillan, AOP Vin de Savoie (2,50/4)
Apremont 2015, Giachino, Chapareillan, AOP Vin de Savoie (3/5)
Marius & Simone 2015, Giachino, Chapareillan, Vin de France (4/6)
Apremont „Lisa“ 2015, Jean Masson & Fils, AOP Vin de Savoie (4/6)
(in Klammern die Preise für das Sechzehntel und das Achtel)
…, selbstverständlich nicht ausschließlich diese sieben Weine gibt es glasweise
am Mittwoch, den 5. April und am Freitag, den 7. April
jeweils von 16 bis 22 Uhr
in der Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils, Reindorfgasse 22
Vorschau
In der Karwoche ist der Rudl auf Dienst- und Studienreise. Da bleibt die Weinhandlung Rudolf Polifka et Fils geschlossen.
19. und 21. April: Jahrgang 2007 – zehn Jahre danach
Im Übrigen ist Rudolf Polifka der Meinung, dass man den 27. Jänner, den Tag der Befreiung der Überlebenden aus dem Vernichtungslager Auschwitz zu einem europäischen Feiertag erklären sollte!
Herr Rudolf grüßt fast alles, was blüht!